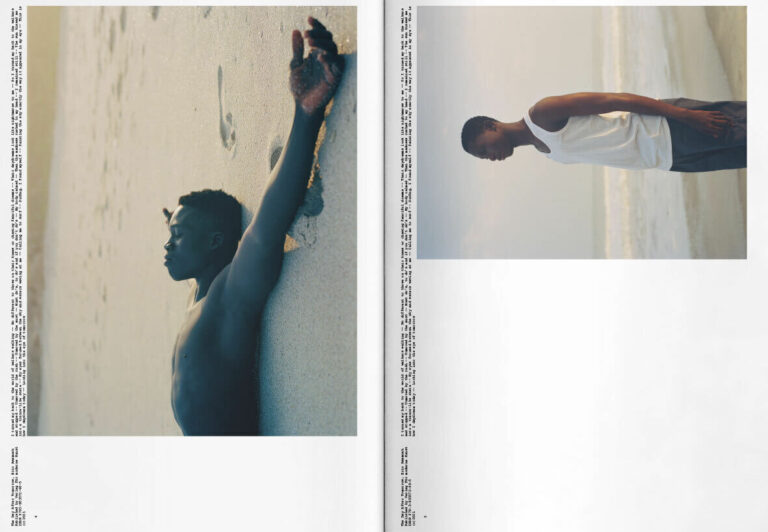Magazin für Kultur, Musik, Kunst und allem was uns gefällt.
Vom Couchtisch, in die Hand, unter die Haut. Zum Schauen, Lesen und Fühlen.
Print und Online.

Sterne implodieren auch im Happyland
Je länger ich über dieses vermeintliche Europa wild in einem Kopf vor mich hin sinnierte, wurde mir klar, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Es geht vielmehr um die unsichtbaren Vorteile, Vorrechte, Ansprüche, die mir zugestanden werden, ohne, dass ich auch nur einen Finger dafür rühren musste. Ich kann Dinge nicht wissen, mir einfach keine Gedanken über Selbstverständliches machen. Privilegien eben. Ich glaub das schwierigste am Erwachsen werden heißt manchmal, die Welt mitsamt all ihren Ungerechtigkeiten anzuerkennen und sich selbst so radikal als möglich an der Nase zu nehmen.
Das Privileg, Privilegien überhaupt unreflektiert zu lassen. Das Privileg weiß zu sein, physisch gesund und psychisch therapiert. Halb studiert und intellektuell privilegiert. Frieden, Neutralität, Demokratie reihen sich ein, in eine Schlange von endlos vielen anderen Privilegien, mit denen ich es mir bequem machen kann, bis sie auf einmal unumgänglich und auch ein wenig schmerzlich (Grüße gehen raus an den guten alten white guilt) ans Tageslicht kommen. Denn jetzt auf einmal sind meine Privilegien ein wenig umgekehrte Psychologie, ich weiß, dass ich sie habe, viel zu viele von ihnen. Ich suhle mich mit ihnen, in einer Mischung aus Weltschmerz und Ohnmacht, gefühlt nichts machen zu können. Eine sehr paradoxe und perfide Tatsache, dass mich erst das Leid der anderen immer wieder, an den Boden der Tatsachen zurückbringt. Es geht nicht um einen Wettbewerb wem es nun besser oder schlechter geht. „Du musst aufessen, denn anderen Kindern geht es viel schlechter als uns“ hallt es da aus meiner Kindheit noch in meinem Kopf nach. (Was natürlich auf mehreren Ebenen problematisch zu betrachten ist.) Wir krönen hier keine*n Gewinner*in wie beim Abschlussball. Lets talk about Privilege baby. Das kann schwierig sein, vorallem wenn man sich selbst Versäumnisse eingestehen muss.
Vielleicht war auch rückblickend das Europa, in dem ich aufwuchs, einfach nur ein weiterer funkelnder Stern in meinem weißen Happyland, welcher nun ausgebrannt auf die Erde zusteuert. Tupoka Ogette, eine deutsche Antirassismus-Trainerin und Bürgerrechtlerin, hat den Begriff des Happylands in ihrem Buch „Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen“ maßgeblich geprägt. Der Begriff beschreibt den Zustand, indem sich weiße Menschen die sich als „Nicht Rassisten“ bezeichnen würden, befinden, bevor sie sich aktiv mit dem eigenen strukturellen Rassismus auseinandersetzen. Oftmals wird Rassismus hier in die politisch rechte Ecke geschoben und als das Böse dargestellt, um sich der eigenen Verantwortung zu entziehen. Was damit zu tun hat, sich selbst nicht wirklich ehrlich oder vollständig mit den eigenen Privilegien auseinandergesetzt zu haben. „The simplistic idea that racism is limited to individual intentional acts committed by unkind people is at the root of virtually all white defensiveness on this topic.”, schreibt die Soziologin Robin DiAngelo in ihrem Buch “White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism”. Ich bin in einem glänzenden Happyland aufgewachsen. Vielleicht flüchte ich mich heute auch noch ab und zu dorthin.
Jede*r da draußen hat das Recht Mitgefühl zu zeigen und die Welt in der aktuellen Lage als belastend zu empfinden. Wir können die Nachrichten auch mal nicht schauen. Wir müssen nicht jeden Liveticker mitverfolgen. Was wir aber müssen ist uns bewusst zu machen, dass wir die freie Entscheidung haben dies zu tun. Sich aber davon lähmen zu lassen, bringt weder dem eigenen Herz noch den Menschen etwas, die tatsächlich Hilfe bräuchten.
In meiner Wohnung hängt eine Seite die ich mal aus einem Magazin gerissen hab, darauf steht: „Verschwende deine Privilegien nicht. Teile sie.“ Die Seite stammt aus dem gleichnamigen Artikel, erschienen in der Zeitschrift Vice. Damals schrieb die US-amerikanische Autorin und Aktivistin Blair Imani, dass auch sie als queere, schwarze Frau Privilegien besitzt, deren sie sich bewusst sein möchte. In dem Artikel zitiert sie die Schwarze Feministin, mit der ich gerne den Text schließen möchte, denn sie sagt: „Ich lernte, mich nicht vor der ungerechten Wahrheit zu verstecken oder Schuldgefühle zu haben, weil ich unverdiente Vorteile genieße. Stattdessen muss ich, müssen wir zum Wohle aller unser Privileg ausgeben“.